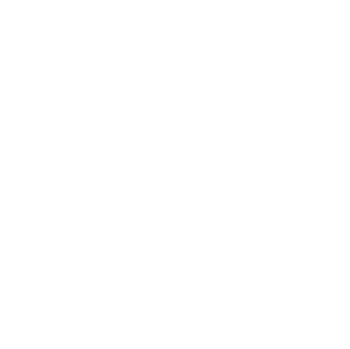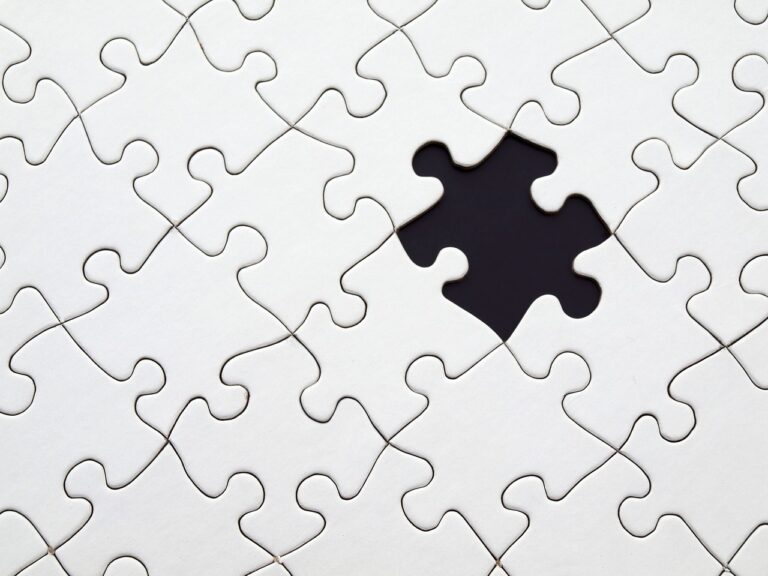Nach Prag wird der Austausch über die Früchte der Synodenarbeit auf lokaler Ebene fortgesetzt. Die ukrainische Kirche, die von der russischen Militärinvasion betroffen ist, konnte in den Diözesen die vorgeschlagenen Themen nicht vertiefen. Dennoch hat sie in der Tragödie des Krieges ein konkretes Gesicht der Nähe und der echten Synodalität entdeckt. Monsignore Oleksandr Yazlovetskiy, Weihbischof von Kiew-Zhytomyr, erzählt uns davon: Er vertraut uns an, dass er sich unter den 200 Delegierten in einem Zustand des Schwebezustandes, der Orientierungslosigkeit befand, als ob er, wie er sagt, „inmitten so vieler Realitäten, die von Harmonie sprechen, ständig eine Trauer in mir trug“.
Die Versammlung wurde mit den Worten von Monsignore Grušas eröffnet, der seine Hoffnung auf ein Ende der russischen Aggression in der Ukraine zum Ausdruck brachte, damit in Europa wahrer Frieden und Versöhnung herrschen können.
Wie haben diese Worte auf Sie gewirkt?
Wir haben es ein wenig erwartet, denn wenn man sich in einem katholischen Umfeld bewegt, findet man immer Solidarität, Trost und Gebete, egal wo man hingeht. Normalerweise bin ich in Kiew, aber ab und zu fahre ich nach Italien, kurz bevor ich hierher kam, war ich in den Vereinigten Staaten, und ich habe immer Worte der Verbundenheit erhalten.
Aber was bedeutet die Synodalität für Sie, ein Jahr nach Beginn des Konflikts?
Um die Wahrheit zu sagen, ist es schwierig, von Synodalität zu sprechen. Als die Synode begann, wurde ich damit beauftragt, die Arbeit der sieben römisch-katholischen Diözesen, die wir haben, zu koordinieren. Wir begannen wie alle anderen mit unseren Hoffnungen und Befürchtungen. Aber als der Krieg ausbrach, hatte offensichtlich etwas anderes Priorität. Es ist schwierig für uns, diese Arbeit fortzusetzen, und um die Wahrheit zu sagen, wollte ich eigentlich gar nicht kommen. Ich verstehe, dass die Welt weitergeht, dass die Kirche sich allen Herausforderungen stellen muss, aber unsere Realitäten und Gedanken sind leider weit weg.
Auf der anderen Seite, wenn wir eine ‚gute‘ Sache betrachten wollen, die uns das Leben im Krieg gebracht hat, dann ist es genau diese Nähe zu den Menschen: in den Unterkünften, beim Tee mit ihnen, beim Helfen mit Freiwilligen. Jede Pfarrei ist zu einer kleinen Caritas geworden, mit so vielen Vertriebenen und so vielen Bedürfnissen. Kurzum, dieser Krieg hat vielen Priestern in der Ukraine geholfen, aus ihren Wohnungen herauszukommen und mit Gebet und Hilfe unter die Menschen zu gehen. Sie waren wirklich sehr gut. Unsere Diözese ist sehr groß, sie war zur Zeit der Massaker in Bucha und Irpin teilweise von den Russen besetzt. Hier bin ich sehr stolz darauf, wie die Priester mit den Menschen umgegangen sind, die auf der Flucht waren. Ich hoffe, dass diese Verbundenheit, die wir heute haben und erleben, nicht verloren geht, sondern erhalten bleibt.
Der Konflikt hat die Kirche also nicht zerrissen?
Nein, er hat nicht gespalten. Ich muss sagen, dass ich am Anfang viele Befürchtungen hatte. Wir jungen und mittelalten Menschen hatten den Krieg nicht erlebt. Aber unsere Leute waren sehr gut. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten Menschen sind der Kirche sehr nahe gekommen. Auch bei uns gibt es viele Paare, die nur standesamtlich verheiratet sind, und wenn der Ruf zur Armee kommt, um zu kämpfen, beschließen sie auch zu heiraten, aus Angst, dass die Männer nicht mehr zurückkommen könnten. Es ist schön, es gibt so viele Eheschließungen, so viele Taufen, so viele Situationen, in denen Menschen versuchen, ihre Beziehung zur Kirche zu regeln.
Quelle: Vatican News